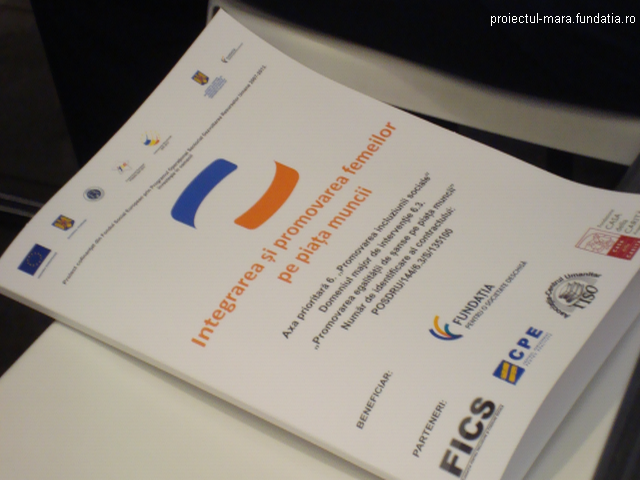Rumänien ist ein Land, in dem sich die Wahrnehmung geschlechtsspezifischer Fragen nach einem modernen Trend ändert, ein Land, das immer noch zwischen der konservativen und der fortschrittlichen Haltung in Bezug auf Gleichstellungsfragen schwankt, aber auch ein Land mit einer eher schwachen Wahrnehmung der Notwendigkeit einer Politik, die sich auf Gleichstellungsfragen konzentriert. Dies waren die wichtigsten Schlussfolgerungen des Geschlechterbarometers im Jahr 2018, das 18 Jahre nach dem ersten Geschlechterbarometer in Rumänien im Jahr 2000 durchgeführt wurde. Das neueste Barometer wurde im Auftrag der feministischen NGO Filia Center erstellt. Es erfasst ganz genau die Veränderung bestimmter Mentalitätsmuster, während andere Mentalitäten in der Zeit eingefroren sind und Unsicherheit in Bezug auf bestimmte Einstellungen entsteht. Häusliche Gewalt, Bildung für Gesundheitsversorgung und Reproduktion, die hohe Zahl der Teenie-Mütter, die in Rumänien in großer Zahl leben — das sind die Themen, die in den letzten Jahren auf die öffentliche Agenda gesetzt wurden. Ebenso möchte das Filia Center, dass die Ergebnisse einer solchen Forschung die Entstehung einer angemessenen Geschlechterpolitik unterstützen. Andreea Braga ist die Vertreterin des Filia Centers. Sie wird uns nun Einzelheiten über den Hintergrund, vor dem das Gender-Barometer ermöglicht wurde, und über die möglichen Lösungen für das Problem mitteilen.
Patriarchale geschlechtsspezifische Vorurteile im Zusammenhang mit Gewalt, aber auch der Mangel an Informationen über häusliche Gewalt und die Dynamik der Gewalt unter Fachleuten vor Ort, Polizisten, Richtern oder Sozialarbeitern, schränken den Zugang von Frauen zu ihren Rechten ein. Von Anfang an stellen wir fest, dass selbst Polizisten Opfer entmutigen, Strafanzeige zu erstatten, so dass einfach nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Ich will nicht verallgemeinern, nicht alle von ihnen verhalten sich so, aber wir wollen, dass so viele Fachleute wie möglich geschlechtsspezifisch sensibel sind, Stereotypen und Vorurteile gegenüber Frauen und Männern überwinden können, damit sie in Fällen häuslicher Gewalt sofort eingreifen können, zumal ihre Intervention den Unterschied zwischen Leben und Tod machen kann. Wir stehen nach wie vor an der Spitze der europäischen Länder, was die Zahl der Mütter im Teenageralter, die hohe Kindersterblichkeitsrate, den begrenzten Zugang zu Gesundheitsdiensten für Mütter betrifft. Es gibt eine große Zahl von Frauen, die es in der Schwangerschaft nie zum Arzt schaffen. Deshalb haben wir eine Lösung vorgeschlagen, die darin besteht, kommunale Netzwerke von Hebammen und Krankenschwestern wiederzubeleben, die ihre Nutznießer erreichen und mit der überwiegenden Mehrheit der Frauen in der Gemeinde zusammenarbeiten können. Wir wollen das Netzwerk der Familienplanungspraxen revitalisieren. Leider gibt es auch eine Art Widerstand der öffentlichen Meinung, wenn wir über reproduktive Rechte und den Zugang zur Geburtenkontrolle sprechen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir das ändern.“
Unter diesen Umständen haben die Ergebnisse des Gender-Barometers von 2000 und des Gender-Barometers im Jahr 2018 im Vergleich nach Meinung der Universitätsprofessorin und Soziologin Laura Grunberg die Entstehung positiver Veränderungen, aber auch den Fortbestand eingefrorener Einstellungen aufgezeigt. Viele der Antworten im Jahr 2018 sind widersprüchlich und deuten auf die Schwankungen der Mentalitäten zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen traditionalistischen und zukunftsorientierten Einstellungen hin. Hier ist Dr. Laura Grunberg, die über eingefrorene Wahrnehmungen spricht.
Auf die Frage, ob der Mann das Familienoberhaupt ist, zeigen die Statistiken, dass 83% der Befragten im Jahr 2000 »Ja« gesagt haben, während im Jahr 2018 immerhin noch 70% die Frage bejaht haben. Das ist jedoch eine gute Entwicklung. Aber ich finde es immer noch schwierig, es als Veränderung zu betrachten, denn 70% ist immer noch viel. Die Situation ist die gleiche, wenn es um die Frage geht, ob Frauen ihrem Mann folgen sollen. In gewisser Weise ist der Wandel hier offensichtlicher, von 78% auf 65%, die erachten, dass die Frau dem Mann hörig sein sollte. Aber ich finde dieses Ergebnis immer noch nicht zufriedenstellend. Es gibt sichtbare Unterschiede, aber die Zahl ist immer noch hoch. Ich hätte erwartet, dass sich die Dinge in 18 Jahren mehr ändern würden.“
Dennoch gibt es im Geschlechterbarometer 2018 viele positive Aspekte. Laura Grunberg:
Es hat sich eine Veränderung in der Art und Weise ergeben, wie die Idee einer weiblichen Präsidentin wahrgenommen wird. Im Jahr 2000 waren die Rumänen damit nicht einverstanden. Im Jahr 2000 gaben etwa 73% der Befragten an, dass sie einen männlichen Präsidenten bevorzugen, während heute nur noch 43% diese Idee unterstützen, was eine fantastische Veränderung ist. Was auch die Vorstellung betrifft, dass Männer besser als Frauen in der Lage seien, zu führen, so ist der Rückgang beträchtlich — von 54% auf 44%. Das bedeutet, dass Frauen genauso gut sind wie Männer, und einige von ihnen sind sogar besser. Auch die Vorstellung, dass Frauen zu sehr mit Hausarbeiten beschäftigt seien und daher keine Zeit hätten, in Führungspositionen zu arbeiten, nimmt von 68% auf 44% ab. Was die Vorstellung betrifft, dass es Frauen an Selbstvertrauen mangelt, so glaubten das 43% der Rumänen im Jahr 2000, im Gegensatz zu nur 31% im Jahr 2018.“
Das Gender-Barometer zeigt deutlich, dass sich die Bemühungen der gemeinnützigen Organisationen ausgezahlt haben, um das Bewusstsein für häusliche Gewalt zu schärfen und rechtliche Maßnahmen gegen Aggressoren und zugunsten des Opfers zu unterstützen. Laura Grunberg:
Im Vergleich zum Jahr 2000 sehen mehr Menschen häusliche Gewalt nicht mehr als eine private Sache an, die innerhalb der Familie angegangen werden muss. Im Gegenteil, die Polizei ist die erste Institution, die diese Fragen lösen sollte. Im Jahr 2000 waren 35% der Befragten der Meinung, dass die Partner ihre Probleme selbst lösen sollten, während derzeit nur noch 20% diese Idee unterstützen und sagen, dass man als aller erstes die Polizei rufen sollte. Das ist ein Mentalitätswechsel, etwas sehr Schwieriges. Also zahlen sich die Bemühungen aus.“
Das Fazit des Gender Barometers lautet, dass sich Rumänien verändert und die Wahrnehmung der Menschen in Bezug auf die traditionellen Rollen von Frauen und Männern diversifiziert.