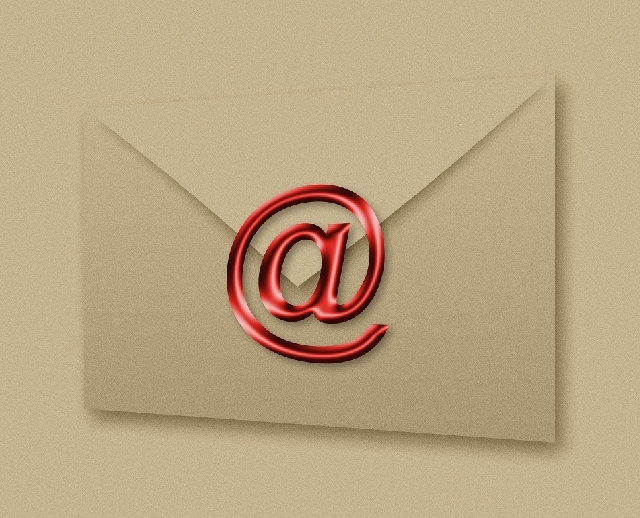Heute möchte ich zu Beginn die QSL-Karte für den Monat Juni für unsere Hörer ohne Internetzugang vorstellen. Auf der QSL Nummer 6 ist eine 25-Bani-Banknote aus dem Jahr 1917 abgebildet. Die 25-Bani-Banknote ist braun und misst 39 x 51 mm. Im oberen Teil der Vorderseite sind die Aufschriften Rumänien“ und Finanzministerium“ zu lesen, den mittleren Teil ziert ein Konterfei des rumänischen Königs Ferdinand I., im unteren Teil sind die Unterschriften des Finanzministers, des Leiters der staatlichen Buchhaltung und des Schatzmeisters zu entziffern. Auf der Rückseite lesen wir die lateinische Phrase Nihil sine Deo“ (Nichts ohne Gott“) und die Warnung, dass Fälschern eine Freiheitsstrafe von 5 bis 10 Jahren droht.
Die Banknote wurde 1917 im Auftrag des Rumänischen Finanzministeriums als Notwährung während des Ersten Weltkriegs herausgegeben. Gedruckt wurde sie vom Geographischen Dienst der rumänischen Streitkräfte und sie gehört zu den ersten rumänischen Banknoten, auf denen das Porträt eines Monarchen abgebildet wurde.
Soweit der vorerst letzte Text von unserer Zentralredaktion, auf unserer Webseite finden Sie im Abschnitt QSL die gesamte Serie für 2020 abgebildet sowie erklärende Texte zu den Karten 1 bis 6. Leider habe ich keine genauen Informationen erfahren können, wann wir ein Budget für Druck und Porto erhalten, damit wir Ihnen die Karten auch zuschicken können. Die Kollegin in der Postbearbeitungsstelle meinte nur, bis Herbst sei eine hoffentlich positive Entscheidung zu erwarten. Ich habe auf jeden Fall Buch geführt über die erhaltenen Empfangsberichte und halte Sie auf dem Laufenden.
Und jetzt zu Hörerzuschriften. Anfang Juni erhielten wir die Zeilen eines offenbar neuen Hörers. Joachim Thiel (aus Wuppertal) schrieb uns per E-Mail:
Da ich nach der Abschlussansage nun die Sendezeiten kenne, werde ich recht bald mal wieder einschalten, denn das Programm ist wirklich hörenswert. Da ich über keinen Empfänger mit DRM verfüge, werde ich mich auf die AM-Sendungen beschränken müssen; ich habe mir ein derartiges Gerät bisher nicht gekauft, weil nach den stark beworbenen Anfängen mit DRM kaum noch Stationen in dieser Modulationsart senden.
Beste Grüße aus Wuppertal!
Vielen Dank für das Feedback, lieber Herr Thiel, und herzliche Grüße aus Bukarest!
Paul Gager (aus Wien) erkundigte sich im Internetformular über die Vorsichtsmaßnahmen in unserem Funkhaus angesichts der Pandemie:
Werte Redaktion!
Laut der deutschsprachigen Redaktion von Radio Slowakei international befindet sich das Team seit 18. Mai wieder auf dem regulären Arbeitsplatz in der Rundfunk-Pyramide in Bratislava. Wann wird es bei RRI so weit sein? Bleiben Sie zuversichtlich!
Vielen Dank für Ihre Anteilnahme an das tägliche Geschehen in unserer Redaktion. Nun, bei uns sind die Einschränkungen bis 15. August verlängert worden. Das heißt konkret, dass jeweils zwei Redaktionsmitglieder turnusmäßig für jeweils zwei Wochen von zu Hause aus arbeiten, während die anderen zu jeweils unterschiedlichen Zeiten und nicht mehr als zwei Leute auf einmal in die Redaktion kommen. Im Funkhaus selbst ist das Tragen einer Maske für alle verpflichtend, in den Studios werden die Mikros nach jedem Sprecher desinfiziert, Besucher und Gäste von außerhalb sind weiterhin untersagt. Das dürfte auch vernünftig sein, denn die Infektionswelle scheint nicht abzubrechen, allein von Freitag auf Samstag wurden 330 Neuerkrankungen und 16 Tote registriert. Die WHO ist auch besorgt und warnt vor einer neuen ansteigenden Infektionswelle weltweit.
Ralf Urbanczyk (aus Eisleben, Sachsen-Anhalt) schickte uns eine interessante Frage:
Über den Parlamentspalast in Bukarest wurde schon oft berichtet, doch der ausführliche Bericht in der Rubrik Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen“ brachte neben vielen bekannten Fakten über dieses faszinierende Bauwerk auch einige interessante Details, die sonst wenig erwähnt werden. Ich weiß noch, wie es nach der rumänischen politischen Wende im Jahr 1989 viele Diskussionen gab, was mit dem halbfertigen Haus des Volkes“ in Zukunft geschehen soll. Sogar der Abriss wurde in Erwägung gezogen. Doch jetzt, 30 Jahre später, scheinen die Bukarester ein neues, besseres, friedlicheres Verhältnis zu dem einstigen sozialistischen Vorzeige-Gebäude gefunden zu haben und in ihm mehr als nur ein Magnet für Touristen zu sehen. Auf Luftaufnahmen des Parlamentspalastes und des Boulevards der Einheit“ fielen mir links und rechts hinter der Straßenfront des Boulevards weitere Gebäude auf. Sind das noch Reste des erwähnten alten Uranus-Stadtviertels oder sind dies auch Neubauten, die in den 80er Jahren oder später neu entstanden sind?
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung, lieber Herr Urbanczyk. Die Häuser direkt an der Straßenfront sind in derselben Zeit wie das Haus des Volkes“ entstanden, nämlich in den Spätachtzigern. Auch sie waren zum Teil noch nicht beziehbar und wurden während der 1990er Jahre fertiggestellt. Es handelt sich überwiegend um Wohnungen, die Räume im Erdgeschoss werden oft gewerblich genutzt, es sind dort also Banken, Geschäfte und Cafés entstanden. Hinzu sind auch einige später errichtete Hochhäuser gekommen, hinter der Straßenfront befinden sich allerdings Überbleibsel des alten Uranus-Viertels, darunter auch ein Kloster. Es ist irgendwie wie eine seltsame Kulissenlandschaft, hinter dem Boulevard taucht man in eine völlig andere Welt ein. Ich muss gestehen, dass sich auch mein Blick auf diesen Stadtteil geändert hat. Ich hielt den Palast und den gesamten Boulevard, der ursprünglich Sieg des Sozialismus“ hieß, für einen Inbegriff der Scheußlichkeit und mied diesen Stadtteil. Inzwischen hat das gesamte Areal aber an Menschlichkeit gewonnen — die Wohnungen sind viel geräumiger als die in den 1980ern üblichen Standards und damit heute recht begehrt. Die Bäume entlang des Boulevards sind in 30 Jahren stattlich gewachsen und durch die vielen Läden und Straßencafés ist die ursprünglich öde Betonwüste zu einer relativ angenehmen Flaniermeile geworden. Und es stimmt: Nach der Wende wurde viel und kontrovers über die Nutzung des Palastes debattiert, ich kann mich noch an eine Pressemeldung von damals erinnern, laut der ein amerikanischer Multimillionär angeboten hätte, das Gebäude dem rumänischen Staat abzukaufen, um darin ein riesiges Casino einzurichten, das sicherlich zum größten Glücksspieltempel der Welt geworden wäre.
1996 fand ein internationaler Architekturwettbewerb in Bukarest statt, der auf die Umgestaltung des gesamten Areals abzielte. Sieger wurde ein deutsches Team unter der Leitung des weltweit bekannten Architekten Meinhard von Gerkan. Sein Projekt sah die Errichtung von modernen und asymmetrisch um das Haus des Volkes positionierten Hochbauten vor, um einerseits ein Gleichgewicht zwischen Horizontale und Vertikale herzustellen und andererseits der erdrückenden Monumentalität des Palastes ihren totalitären Anspruch zu nehmen, wie es Professor Gerkan selbst beschrieb. Das Projekt konnte allerdings nicht umgesetzt werden, einerseits aus Kostengründen, andererseits weil damals die kommunalpolitischen Zuständigkeiten und die Eigentumsverhältnisse der Grundstücke nicht geklärt bzw. umstritten waren. 1998 fand eine Ausstellung der Wettbewerbsprojekte in Bukarest statt, Professor Von Gerkan war dabei und ich habe ihn bei dieser Gelegenheit auch interviewt. Daraus wurde ein 27-einhalb-minütiger gebauter Beitrag über die baupolitische Geschichte der Stadt Bukarest, der im November 1998 in unserem Programm — ebenfalls in der Reihe Kulturinterferenzen“ — ausgestrahlt wurde. Ich musste auch staunen über die Länge des Beitrags — anspruchsvolle Features in dieser Länge findet man heute nur noch bei Kultursendern. Ich habe für Sie ein etwa sechsminütiges Fragment ausgesucht, in dem auch der Architekt Meinhard von Gerkan zu Wort kommt. Und — was für ein Zufall! — den damaligen Beitrag sprachen jüngere Versionen von Daniela Cîrjan und mir ein.
Doch zuvor möchte ich noch schnell die Postliste verlesen. Ein paar Postbriefe sind eingetroffen, ich lese sie bis nächsten Sonntag. Auf elektronischem Wege erhielten Post wir bis einschließlich Samstag von Jörg-Clemens Hoffmann, Carsten Fenske, Klaus Nindel, Anna Seiser, Michael Willruth, Gerd Brüschke, Fritz Andorf, Herbert Jörger, Andreas Fessler, Helmut Matt, Peter Vaegler und Franz Bleeker (D) sowie von Paul Gager (A) und Siddhartha Bhattacharjee (IND).
An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag und überlasse Sie dem Fragment aus der Sendung vom 17. November 1998. Machen Sie’s gut und bleiben Sie gesund!
Audiobeitrag hören: