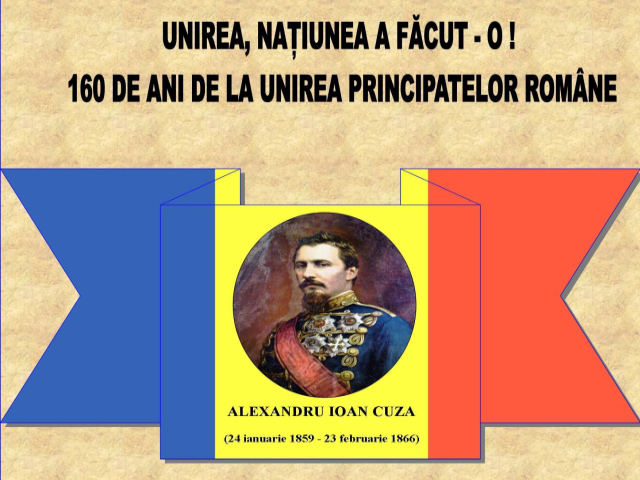Unter dem Titel „Die ersten Angehörigen der Cantacuzino-Familie im Bestand des Stadtmuseums Bukarest“ widmet sich die Ausstellung den Anfängen dieser bedeutenden Adelsfamilie. Mihaela Rafailă, Kuratorin und Expertin der Abteilung für moderne und zeitgenössische Geschichte des Bukarester Stadtmuseums, erläutert die Absicht hinter dem Projekt.
„Mit der temporären Ausstellung zur Cantacuzino-Familie möchte ich der Öffentlichkeit bedeutende historische Schriftstücke aus dem 17. und 18. Jahrhundert vorstellen. Diese Dokumente, verfasst auf Papier oder Pergament in kirchenslawischer und rumänischer Sprache mit kyrillischen Buchstaben, erwähnen Mitglieder der Cantacuzino-Familie in unterschiedlichen Kontexten. Sie erscheinen sowohl als Zeugen im Fürstlichen Rat, durch die Ämter, die sie dort innehatten, als auch als Unterzeichner von Kaufverträgen oder als Aussteller von Urkunden und Orden. Besonders hervorzuheben sind dabei Șerban und Ștefan Cantacuzino.”
Der Kammerherr Constantin Cantacuzino, eine zentrale Figur der Ausstellung des Bukarester Stadtmuseums, war der erste bedeutende Vertreter dieser adligen Familie aus der Walachei. Geboren 1598 und ermordet 1663, war er nicht nur ein großer Herrscher und Kulturschaffender, sondern auch ein Woiwode. Mihaela Rafailă erzählt uns mehr über seine außergewöhnliche Persönlichkeit und seinen Einfluss.
„Nach seiner Heirat mit Fräulein Elina, der jüngsten Tochter des Woiwoden Radu Șerban – zu Hause liebevoll Ilinca genannt – begann Constantin Cantacuzino seinen Aufstieg an den walachischen Höfen. Sein persönlicher Reichtum, den er geerbt und vermehrt hatte, wurde durch die Mitgift seiner Frau weiter gesteigert. Dadurch war es ihm möglich, seine elf Kinder – sechs Söhne und fünf Töchter – in die einflussreichsten Familien der wohlhabenden Bojaren aus der Walachei und Moldawien einzuheiraten. Als Kammerherr genoss Constantin Cantacuzino hohes Ansehen. Seine umfassende Bildung und seine Leidenschaft für Bücher zeichneten ihn ebenso aus wie seine wirtschaftlichen und diplomatischen Verbindungen. Besonders bei den Türken war er angesehen, was ihn zu einem engen Vertrauten des Woiwoden Matei Basarab machte. Im 17. Jahrhundert prägte Cantacuzino als eine der dominierenden Persönlichkeiten die rumänische Politik nachhaltig.“
Die Kuratorin Mihaela Rafailă stellt auch Elina Cantacuzino (1611–1687), die Ehefrau des großen Adligen Constantin Cantacuzino, in kurzen Zügen vor.
„Elina Cantacuzino bewies außergewöhnliche Stärke und Charakter. Sie zeigte Vergebung gegenüber den Mördern ihres Mannes, große Entschlossenheit bei der Rettung des Hauses nach dem Verlust der familiären Stütze und Umsicht bei der gerechten Aufteilung des Vermögens unter ihren Kindern. Ihre Liebe zu ihren Söhnen zeigte sich in den sanften, aber eindringlichen Ratschlägen, stets wie Brüder zusammenzuhalten. Darüber hinaus beeindruckte sie durch ihren Mut, indem sie selbst die weite und beschwerliche Reise zu den Heiligen Stätten unternahm.”
Welche Dokumente, die für die Geschichte dieser berühmten rumänischen Familie von Bedeutung sind, zeigt die Ausstellung den Besuchern?
„In der Ausstellung wird Constantin Cantacuzino, der Begründer der Cantacuzino-Familie in der Walachei, erstmals in einer Urkunde vom 8. Juni 1626 erwähnt. Dort erscheint er als Zeuge des Fürstlichen Rates und bekleidete das Amt des Oberkammerherrn.”
Die Ausstellung „Die ersten Angehörigen der Cantacuzino-Familie“ präsentiert der Öffentlichkeit drei bedeutende Werke, die für die rumänische Kulturgeschichte von herausragender Bedeutung sind. Im Mittelpunkt steht die „Bukarester Bibel“, auch bekannt als „Șerban Cantacuzinos Bibel“. Dieses Werk markiert die erste vollständige Übersetzung der Bibel ins Rumänische und wurde im Jahr 1688 veröffentlicht. Mihaela Rafailă ergänzt weitere Details zu dieser außergewöhnlichen Veröffentlichung und ihrer kulturellen Bedeutung.
„In der Ausstellung sind auch drei Bücher zu sehen. Das erste ist „Das heilige und göttliche Evangelium, verfasst nach der griechischen Tradition der Evangelien“. Dieses wurde im Auftrag und auf Kosten von Herrn Serban Cantacuzino im Jahr 1682 gedruckt.
Zudem wird die Bibel, auch als „Bukarester Bibel“ bekannt, in der Ausstellung präsentiert. Auch die „politische und geografische Geschichte der Walachei“ wird in der Ausstellung behandelt. Der Autor dieses Werks wurde von dem großen Historiker Nicolae Iorga als der erste Hofbeamte Olteniens, Mihai Cantacuzino, identifiziert.
Doch zurück zur Bibel, sie gilt als die erste vollständige Übersetzung der Heiligen Schrift ins Rumänische und wurde im Auftrag „unseres gütigen christlichen und erleuchteten Herrn Ioan Șerban Cantacuzino Voievod“ angefertigt. Die Bibel, die auf Papier mit Wasserzeichen gedruckt wurde, ist von besonderer Bedeutung. Ihre Einbände bestehen aus mit Leder umwickelten Holztafeln, deren Verzierung im Heißpressverfahren hergestellt wurde.
Die Veröffentlichung der Bukarester Bibel war ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Etablierung der Landessprache als liturgische Sprache und gleichzeitig ein Meilenstein der typografischen Kunst in der Walachei. Sie legte die Grundlagen für die Schriftsprache der Kirche und hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die religiöse und kulturelle Entwicklung der Region.
Die Bibel fand weite Verbreitung in den rumänischen Ländern – in der Walachei, Moldawien und Siebenbürgen – und gelangte sogar bis nach Polen, als ein Exemplar dem ehemaligen Metropoliten Dosoftei, der im Exil lebte, übergeben wurde. Ein weiteres Exemplar befand sich im Besitz von Papst Benedikt XIV. und wird heute in der Bibliothek der Universität von Bologna aufbewahrt. Zudem zirkulierte die Bibel in Siebenbürgen, in den Landkreisen Alba und Hunedoara.”